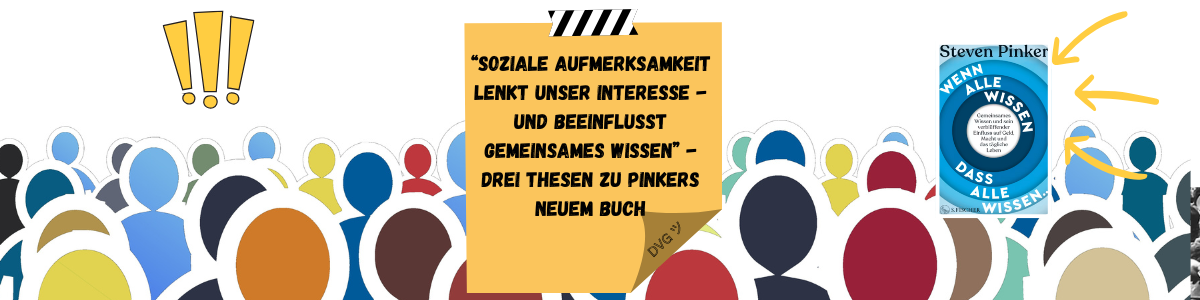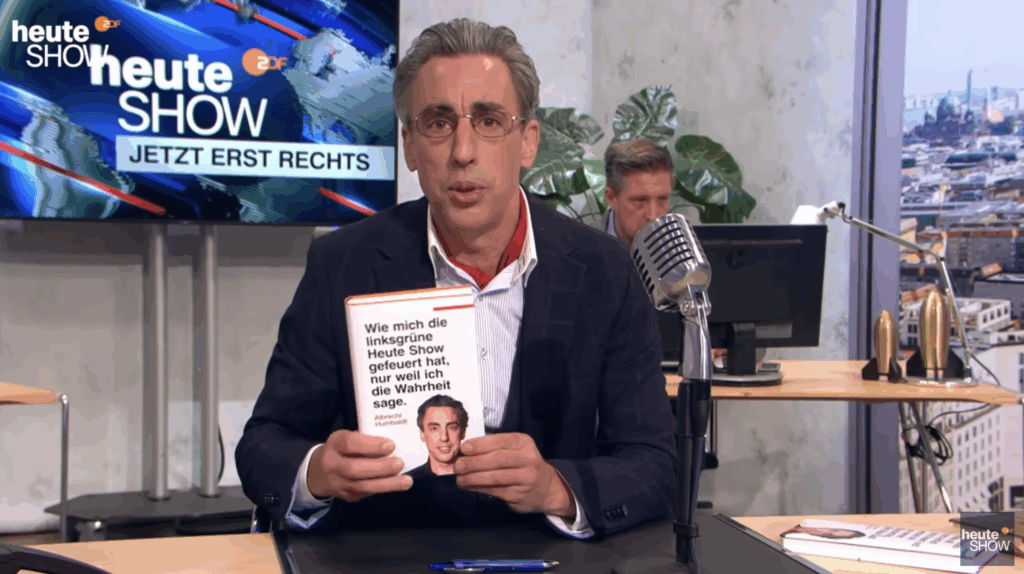Dieser Text ist Teil der Oktober-Folge meines monatlichen Newsletters „Digitale Notizen“, der immer zum Ende eines Monats erscheint. Hier kannst du ihn kostenlos abonnieren.
Das neue Buch von Steven Pinker heißt auf deutsch „Wenn alle wissen, dass alle wissen“ und beschäftigt sich mit dem Phänomen des Common Knowledge – also dem Wissen darum, dass andere ebenfalls etwas wissen und wie deren Wissen wiederum unser Wissen beeinflusst. Am besten lässt sich dies am Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ von Hans Christian Andersen illustrieren. Denn erst als der kleine Junge das private Wissen aller einzelnen durch seinen Ausruf, der Kaiser trage ja gar keine Kleider, zu einem öffentlichen, bzw. gemeinsamen Wissen macht, fällt der Betrug allen auf – bzw. alle wissen nun, dass alle es wissen!
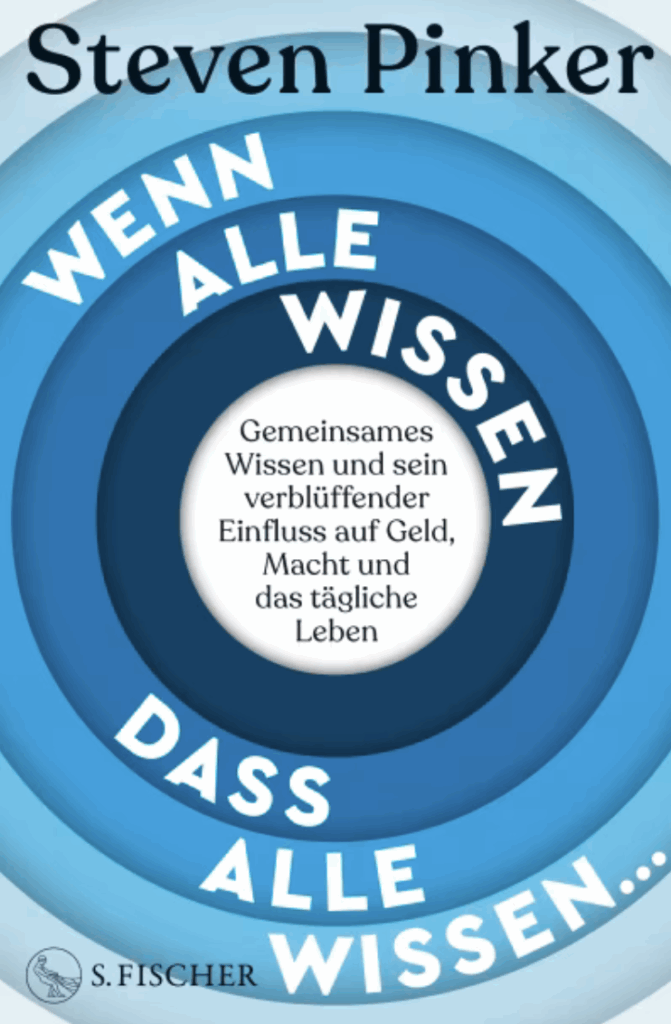
Pinker befasst sich sehr detailreich mit diesen Facetten des wechselseitigen Wissens. Das ist psychologisch und zum Teil mathematisch interessant. Wer sich für Diskurse und öffentliche Kommunikation interessiert, findet viel Inspiration in Pinkers Beschäftigung mit der Frage: Wie beeinflusst uns die Annahme oder das tatsächliche Wissen darüber, was andere wissen bzw. was die anderen denken, was sie vom Wissen der anderen wissen?
Die sich daraus ergebene Idee von Öffenltichkeit und öffentlichem bzw. gemeinsamem oder wechselseitigem Wissen wird bei Pinker allerdings durchgängig im Singular gedacht. „Die anderen“ sind aber gerade in digitalen Räumen oft nicht eine Gruppen, sondern sehr viele Gruppen mit sehr unterschiedlichen Wissens- und Referenzsystemen. An der Debatte darüber, welche Meme-Referenzen z.B. auf den Patronenhülsen beim Mord an Charlie Kirk verwendet wurden oder am Prinzip der Diskursverschiebung durch das so genannte Dog-Whistings lässt sich zeigen, wie spannend die Frage des wechselseitigen bzw. gemeinsamen Wissens ist, wenn Gemeinsamkeiten und Öffentlichkeiten aufgesplittet sind – und das Nicht-Wissen zum Dinstinktionsmittel wird. Zwar widmet sich Pinker dem Phänomen des indirekten oder codierten Sprechens (Netflix & Chill) geht aber nicht weiter darauf ein, wie aus dem Ausschluss von wechselseitigem Wissen Gruppenzugehörigkeiten geprägt (siehe dazu z.B. Die Glut-Theorie der öffentlichen Debatte) und neue Bedeutungen erschaffen werden.
Nachdem ich mir das Hörbuch angehört hatte, ergaben sich bei mir einige anschließende Fragen, die ich hier in Form von drei ergänzenden Thesen teilen möchte:
1. Ohne soziale Aufmerksamkeit kein gemeinsames Wissen
Dass wir z.B. auf einem YouTube- oder Instagram-Account über die (im Kern wertlose) Anzahl so genannter Follower informiert werden, hat nur einen Grund: uns soll gemeinsames Wissen und daraus erwachsene soziale Bedeutung vorgegaukelt werden. Denn die Followerzahl wird von Plattformen als Ausdruck dessen genutzt, was Pinker gemeinsames Wissen nennt – die Annahme, dass viele Leute diesen Account kennen. Nicht nur, weil Follower durchaus Bots sein können, wissen wir, dass diese Zahl nicht für tatsächliches Wissen steht, sondern für einen Wert, den ich soziale Aufmerksamkeit nennen würde. Eine Vorstufe zum gemeinsamen Wissen, ein Ausdruck digitaler Öffentlichkeit(en) – die Annahme, dass potenziell viele Menschen hier zuhören könnten.
Diese Form von sozialer Aufmerksamkeit ist zumindest indirekt auch dafür verantwortlich, dass Menschen in sozialen Netzwerken statusorientiert debattieren – das imaginierte Publikum und dessen soziale Aufmerksamkeit verlangen danach, Gewinne zu erzielen und Kompromisse zu vermeiden. Es schauen ja andere zu. So lässt sich die Annahme zusammenfassen, auf der Interaktion in sozialen Medien ausgeübt wird.
2. Soziale Aufmerksamkeit ist ein wichtiges Feld der Kommunikation
So wie wir persönlich Mehr Aufmerksamkeit für Aufmerksamkeit aufwenden sollten, sollten wir in der Kommunikation(sforschung) mehr Aufmerksamkeit auf das Wissen der anderen lenken: also auf die soziale Aufmerksamkeit. Man könnte sogar sagen, dass alle Debatten um das so genannten Cancelling sich nur darum drehen: um die soziale Aufmerksamkeit der anderen! Etwas ist so falsch, dass wir es nicht gut aushalten, dass noch mehr Leute davon erfahren.
Wie die vermeintliche bzw. tatsächliche Unterdrückung von Inhalten aber als Booster für die soziale Aufmerksamkeit wirken, hat die heute-show in einem Beitrag über die Aufregung rund um Julia Ruhs ganz gut auf den Punkt gebracht – inklusive des erfundenen Buchs „Wie mich die links-grüne heute-show gefeuert hat, nur weil ich die Wahrheit sage“.
Diese Dimension von Kommunikation erlangt neue Bedeutung, weil Gatekeeper wegfallen, jede und jeder selbst Öffentlichkeit herstellen kann. Daraus folgt, dass wir neue Filter brauchen, die uns helfen rauszufinden, wem wir wofür unsere Aufmerksamkeit schenken wollen – und ein besonders wirksamer Hebel dafür ist die Form von Ragebait, die behauptet: Jemand will nicht, dass du das hier erfährst! (völlig egal, ob das stimmt)
3. Gemeinsames Wissen formt Gruppen – und schließt aus
Dass aber nicht nur behauptetes, sondern auch tatsächliches Nicht-Wissen ein Antrieb sein kann, sieht man an memetischen Mustern der öffentlichen Debatte: Gerade weil jemand etwas nicht versteht, wird eine Sache spannend. Im harmlosen Fall kann man das am Hype um die öffentliche Pudding-Speise mit Gabeln sehen. In schwerwiegenderen Fällen ist das Unverständnis der anderen, Antrieb für Sprachcodes wie dem „Well well well“-Kommentar oder bei blauen Herzen.
In einer immer weiter diversifizierten Gesellschaften werden solche Gruppencodes vermutlich zunehmen und eine Herausforderung für die Übersetzungsleistung stellen. Wie kann man zwischen unterschiedlichen Gruppen vermitteln, wenn Begriffe nicht mehr das gleiche meinen? Und wenn sogar unterschiedliche Sprachen genutzt werden?
Mehr zu diesem Thema im Blog…
- Gender-Gegner missachten die Freiheit der Sprache
- Wer bestimmt über deine Aufmerksamkeit?
- Die Annahmen der Anderen
- Wie dein Widerspruch unerwünschte Folgen anfeuert
- Eine wichtige Waffe gegen den Terror: deine Aufmerksamkeit
… und im Minifesto „Wesentlich weniger“
Dieser Text ist Teil meines monatlichen Newsletters „Digitale Notizen“, der immer zum Ende eines Monats erscheint. Hier kannst du ihn kostenlos abonnieren.