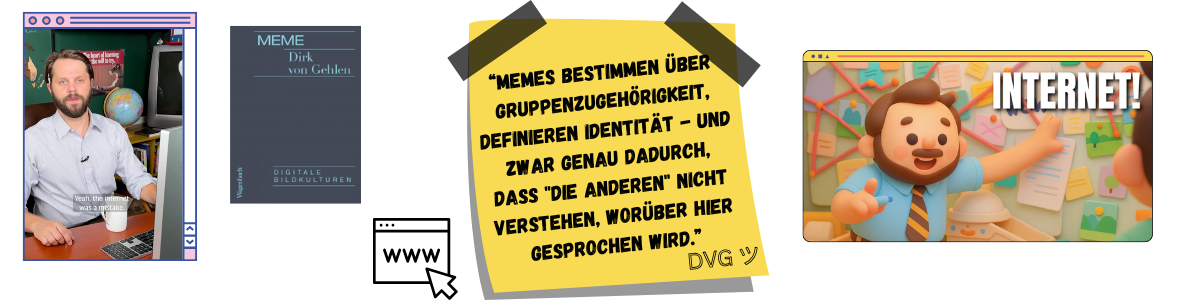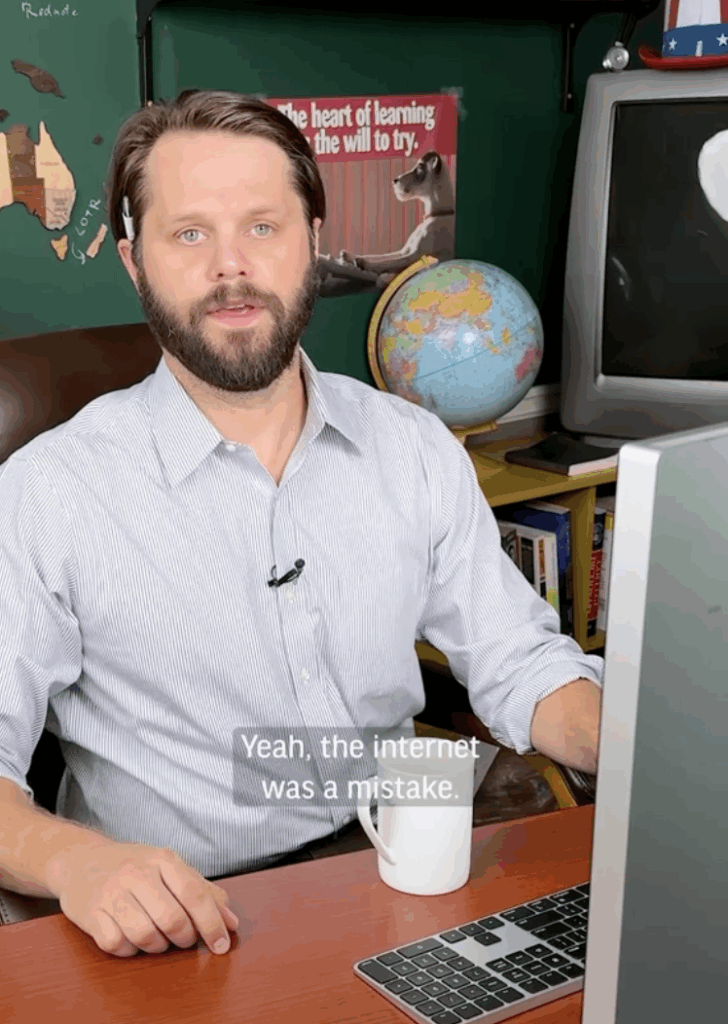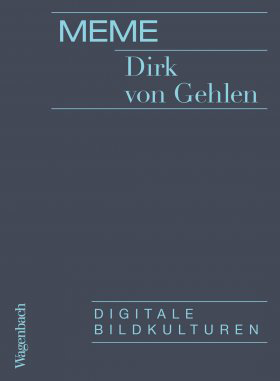Selten wurde innerhalb einer Woche so viel über Internetkultur und Memes berichtet und gleichzeitig gab es dabei rein gar nichts zu lachen. Der Mord an Charlie Kirk und die anschließende Suche nach den Motiven des mutmaßlichen Täters haben „memes, gaming und internet culture“ auf eine Weise ins Licht einer breiteren Öffentlichkeit gerückt, dass es Zeit für ein paar Fragen ist. Hier fünf Fragen – und kurze Antworten zu dem, was wir bisher wissen (Fotos oben Meme-Studio, rechts; Screenshot, links).
Worum gehts überhaupt?
Das Socialmediawatchblog bringt die Situation so auf den Punkt: Mit Blick auf den mutmaßlichen Mörder von Charlie Kirk schreiben sie: wir wissen „zu wenig, um verlässliche Aussagen über seine Überzeugungen und Motive zu treffen. Rechte halten Robinson für einen Linken (NYT), Linke für einen Rechten (Belltower-News). Für beide Lesarten gibt es Indizien, aber keine Belege (The Verge).“ An der Diskussion über die Botschaften, die er hinterlassen hat, lässt sich aber eine Menge über Memes, das Netz und die Idee von Öffentlichkeit(en) ablesen:
Welche Themen dabei eine Rolle speilen, bringt dieser Clip von Dave Jorgenson am besten auf den Punkt. Dave ist der Mann, der der Washington Post Tiktok beigebracht hat – und hier auf seinem privaten Account auch nicht an Kritik an seinem Arbeitgeber spart. Im deutschsprachigen Raum hat Christian Stöcker in seiner Spiegel-Kolumne sehr gut beschrieben, wie die Botschaften, die der mutmaßliche Mörder auf Patronenhülsen hinterlies, eine Debatte über seine Intentionen auslöste. Der Guardian überschrieb seinen Tech-Newsletter in dieser Woche mit dem Titel „How memes, gaming and internet culture all relate to the Charlie Kirk shooting“ – und referenziert den ersten und besten Text, der zu dem Thema verfasst wurde: Ryan Broderick und Adam Dumas haben ihn im unbedingt empfehlenswerten Blog Newsletter garbage day verfasst und ihm den Titel Killed by a Meme gegeben.
Aber was hat all das mit Memes zu tun?
Ihre große gegenwärtige Bedeutung bekommen Memes nicht durch ihren Humor oder ihre besondere digitale Verbreitung. Der besondere Zauber an Memes erwächst aus dem Unverständnis der anderen. Memes funktionieren wie geheime Passwörter (Schibboleth) oder Dialekte. Sie sind Ausschlussinstrumente, die Zugehörigkeit durch bestimmte Codes regeln. Wer das Kerngehäuse eines Apfels auf die gleiche Weise wie ich bezeichnet, gehört zu meiner Gruppe. Genauso verhält es sich mit der Interpretation bestimmter Zeichen und Referenzen. Sie bestimmen über Gruppenzugehörigkeit, definieren Identität – und zwar genau dadurch, dass „die Anderen“ nicht verstehen, worüber hier gesprochen wird. (Details dazu in der Analyse zur Glut-Theorie)
Das gilt für die Icebucket-Challenge sehr ähnlich wie für die Codes auf den Patronenhülsen. Wer sich dieser Dynamik nicht bewusst ist, wird im Entziffern der Codes keinen Erfolg haben, sondern nur finden, was sie oder er schon vorher weiss. Broderick/Dumas zeigen das in ihrem Text sehr deutlich. Sie begeben sich in die Tiefen von Communities, deren Ausrichtung äußerst komplex und deren Referenzen häufig ironisch gebrochen sind.
Was hat das mit Internetkultur zu tun?
„This kind of content is basically the waters that young people swim in now“ sagt Ryan Broderick in diesem Clip, in dem er die unterschiedlichen Interpretationen zusammenfasst. Diese Gewässer sind tief – und für viele, die metaphorisch gesprochen kein Interesse am Schwimmen haben, völlig unerforscht. Berit Glanz formuliert dies in ihrem sehr guten Text zum Thema so: „In der Reaktion auf die Ermordung von Charlie Kirk wurde wieder einmal deutlich, wie extrem groß in den letzten Jahren der Abstand zwischen Internetkultur und Offlinekultur geworden ist. (…) Es ist ein zunehmend brennendes Problem, dass die etablierten Institutionen seit Jahren verweigern sich mit der Rolle von Onlinekultur auseinanderzusetzen, obwohl seit vielen Jahren Offlinegewalt aus Internetkultur entsteht.“
Wobei sie auch sehr richtig festhält, dass Internetkultur viel mehr ist, als die Radikalisierung in bestimmten hasserfüllten Gruppen – aber sie ist dies eben auch. Und die Muster, mit deren Hilfe zum Beispiel die so genannten Groypers sich online radikalisieren, basieren auf den oben genannten Kriterien von Ausschluss und Unverständnis.
Ist hier ein Versagen klassischer Medien zu erkennen?
„Das Internet ist das mächtigste politische Instrument unserer Zeit,“ schreibt Taylor Lorenz bei Hollywood Reporter, „aber die meisten Medienorganisationen kümmern sich erst drum, wenn es zu Breaking News kommt.“ In einer Analyse bei Übermedien kommt Gavin Karlmeier zu folgendem Schluss: „Der mutmaßliche Mörder von Charlie Kirk wird häufig als „extremly online“ bezeichnet. Aber wie viele Texte von Menschen, die selbst „extremly online“ sind, haben Sie in deutschsprachigen Medien gelesen? Echte Einordnung lieferten stattdessen Posts bei Bluesky, Reddit oder Newsletter. Während es Korrespondent:innen für Landespolitik, für die AfD, für Sicherheitspolitik oder gar den Kunstmarkt gibt, wird die sogenannte Internetkultur meist von denen abgedeckt, dessen Fachbereich sie gerade berührt – angereichert mit angelesenem Wissen. Angelesenes Wissen über eine Welt, die längst keine Nische mehr ist, sich quasi minütlich weiterentwickelt und sich immer stärker an sich selbst abarbeitet.“ Damit liegt er vermutlich nicht ganz falsch – die Aufgabe der Übersetzung von on- zu offline ist noch immer nicht bewältigt und die aktuelle Woche zeigt: sie wird immer größer.
Was folgt aus all dem?
Öffentlichkeit ist ein Pluralwort. Und die Art und Weise wie Öffentlichkeiten sich strukturieren folgt nach memetischen Prinzipien. Das sieht man zum einen daran, welche Narrative benutzt werden, um das Geschehen einzuordnen (Bei McSweeneys haben sie dazu eine sehr gute Analyse veröffentlicht: How to tell the difference between a lone wolf and a coordinated efforrt by the radical left). Es wird aber vor allem deutlich an der Art, wie versucht wird die Codes (Memes) zu entziffern. Dass dabei in sehr einfachen Denkmustern argumentiert wird (wer gegen rechts ist, muss links sein) ist dabei nur ein Problem, wie Katherine Dee im Default Blog schreibt: „Übertriebene Vereinfachungen sind nicht nur schlampig – sie hindern uns aktiv daran, die wirkliche Dynamik unserer über 30 Jahre alten Online-Welt zu verstehen. Sie machen uns blind für das, was tatsächlich passiert. Was wir nicht brauchen, sind weitere generalistische „Internet-Versteher“, die auf der Jagd nach Einfluss sind oder sich für denjenigen einsetzen, der sie bezahlt. Was wir brauchen, sind Forscher, die bereit sind, bestimmte Gebiete sorgfältig zu kartieren.“
Ich verwende den Begriff Netzkultur um Phänomene zu beschreiben, die ihren Ursprung in der digitalen Welt haben. Häufig handelt es sich dabei um derlei Artefakte, die ich in dem Buch Meme – Muster digitalter Kommunikation beschrieben habe. Manchmal sind es aber auch Trends oder kurzzeitige Hypes. Einmal im Monat fasse ich sie in den Netzkulturcharts zusammen, die ich mit meinem Newsletter verschicke.