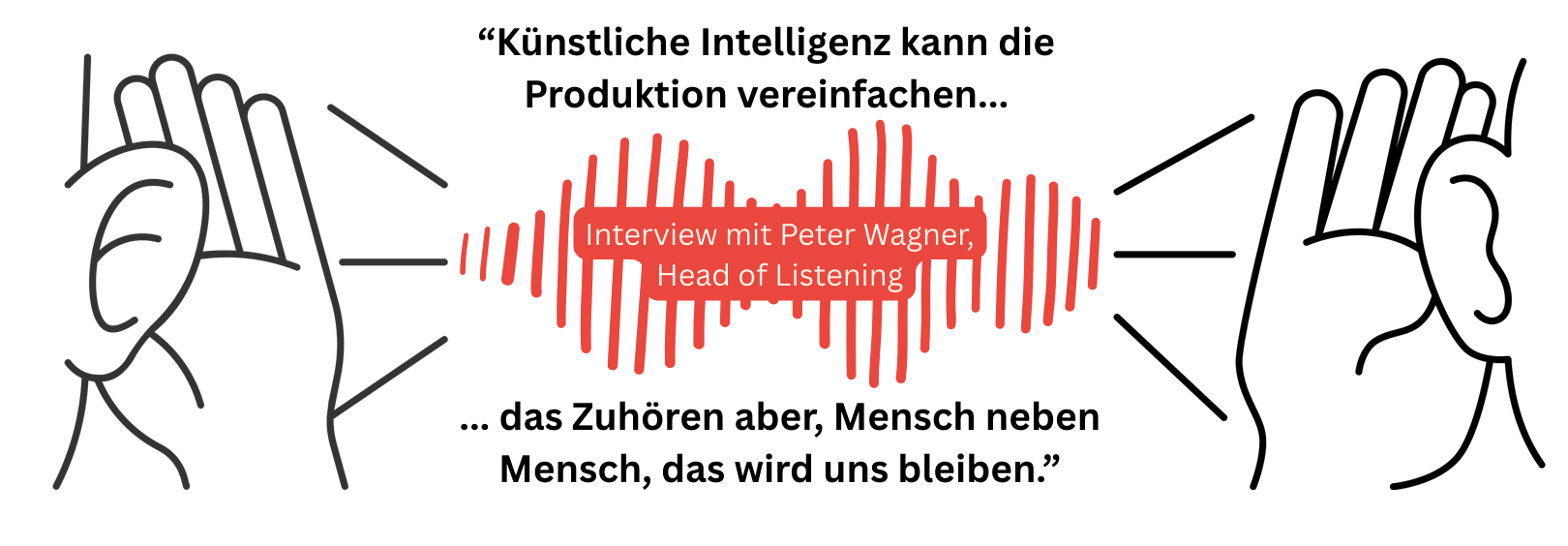Seit unserer gemeinsamen Zeit bei jetzt.de bin ich mit Peter Wagner befreundet. Unlängst überraschte er mich mit einem Eintrag auf LinkedIn, der mich so sehr fasziniert hat, dass ich ihm ein Chat-Interview vorschlug. Hier ist das Ergebnis:
Du hast in deiner LinkedIn-Bio „Head of Listening“ geschrieben. Wie kommst du dazu?
Ich arbeite seit Jahren in der Kommunikation, ich schreibe, redigiere, filme oder moderiere. Das Ergebnis sind Texte, Bewegtbild oder Veranstaltungen. Daran werde ich gemessen. Dabei setzen diese Ergebnisse Vorarbeiten voraus, in denen es meist ums Zuhören geht. Ein Beispiel: Ich besuche für die interne Kommunikation eines Unternehmens eine Messe und spreche mit zehn Kolleginnen über ihre Eindrücke. Was dann zählt, ist der kleine Text fürs Intranet – und nicht die sechs Stunden, die ich den Leuten auf der Messe zugehört habe, in denen jede Kollegin im Gespräch die Chance hatte, ihre Arbeit zu beschreiben, Entwicklungen zu kommentieren oder eine Idee für das Unternehmen zu formulieren. Kommunikation besteht zu 20 Prozent aus Produktion und zu 80 Prozent aus Zuhören. Mir war es ein Anliegen, den 80 Prozent ihren Platz in meiner Jobbeschreibung zu geben.
Ich glaube ja, dass genau diese Aufmerksamkeit in einer Welt voller KI-Inhalte noch wichtiger wird. Gleichzeitig frage ich mich immer: Wo lernt man das?
Jap, genau mein Gedanke. Künstliche Intelligenz kann die Produktion vereinfachen. Das Zuhören aber, Mensch neben Mensch, das wird uns bleiben. Wie man es lernt? Wahrscheinlich müssen wir es nicht lernen, sondern nur üben. Wir sind so sehr auf Senden geeicht, auf Botschaft, auf Kommentierung, dass das echte Zuhören – ohne Reingrätschen, ohne Dauerkommentierung, ohne Wertung – eine Leistung geworden ist. Geht mir ja selbst so. Aber ich glaube, es ist eine Fähigkeit, die das Zusammenleben besser machen kann.
Das journalistische Format, das diesem Zuhören am nächsten kommt, ist vermutlich das Interview. Du führst solche Interviews für den Eichenau Podcast, den du mit Lena Jakat machst. Ihr habt den unlängst beim b-future-Festival vorgestellt. Danach las ich irgendwo den Satz „Zuhören ist das neue ,Sagen, was ist'“. Kannst du das erklären?
Die Formel »Sagen, was ist« ist top-haltbar, keine Frage. Aber Journalismus wird künftig mehr sein müssen, wenn er sich noch finanzieren will, wenn er seine Funktion als gesellschaftlicher Kitt behalten will.
Was muss er sein?
In der journalistischen Arbeit sind viel mehr Spielweisen angelegt, als sie derzeit genutzt werden. Bei der b. future wurde mir das klar. »Sagen, was ist« ist nur ein Teil der journalistischen Möglichkeit. Journalistische Geschichten können wie Theater auf der Bühne funktionieren. Journalistische Marken können mit Genossenschaftsmodellen Lesende zu Teilhabern machen. Journalismus kann in die Nähe der Sozialen Arbeit rutschen, wenn ein Laden in der Ortsmitte zum lokalen Zuhör-Newsroom, zum sozialen Zentrum für Austausch und Ortsentwicklung wird. Klar, viele dieser Projekte tragen sich nicht ohne Förderung. Aber das wird sich ändern, das war in der Landwirtschaft auch so.
Landwirtschaft?
Die Landwirtschaft wird unter anderem deswegen subventioniert, weil sie eine gesellschaftliche Funktion erfüllt, die über die Nahrungsmittelproduktion hinausgeht. Mit den Fördergeldern zahlen wir die Landschaftspflege, die Landwirte betreiben, während sie Kartoffeln anbauen oder Tiere weiden lassen oder Blühstreifen säen. So bleiben Wege zum Radeln und Wandern nutzbar, so erleben wir zumindest in bestimmten Regionen eine abwechslungsreiche, farbige, belebte Kulturlandschaft im Wandel der Jahreszeiten. Gleiches gilt, wenn wir Journalismus in all seinen Spielweisen pflegen: dann florieren die Gesellschaft, die Debatten, die Demokratie.
Also: Förderung für journalistisches Zuhören?
Jap.
Wo journalistisches Zuhören heute schon praktiziert wird, ist in der Unternehmenskommunikation. Kannst du davon ein wenig erzählen?
Ich habe zuletzt in einem Konzern mit mehreren Tausend Mitarbeitern gearbeitet und viel für die interne Kommunikation produziert. Wir hatten ein sehr soziales Intranet, in dem es Austauschorte für die verschiedensten Gruppen und Interessen gab. Mit Corona entstand sogar eine monatliche digitale Talkshow, es gab Townhall-Formate mit Fragerunden. Also: Es fehlte nicht an Teilhabe. Trotzdem ist es wie überall, die Zahl derer, die kommentieren, die mitmachen ist begrenzt. Weil die Arbeit vorgeht, weil der Chef mitliest. Hier liegt ein Feld brach, das idealerweise die Kommunikation besetzt.
Wie meinst du das?
Es braucht Menschen, die in der Belegschaft unterwegs sind, die zuhören, auch anonym, die Entwicklungen, Bedenken und Ideen verfolgen und an die richtigen Stellen tragen. Ich habe das selbst immer wieder versucht, bei Standortbesuchen. So fühlen sich Mitarbeitende gesehen, so entsteht mehr Transparenz und auch die Chance für Weiterentwicklung. Für interne Innovation zum Beispiel braucht es Menschen, die wissen, was in diesem und in jenem Teil einer Organisation passiert. Und das dann zusammenführen.
Diesen Innovations-Aspekt sehe ich auch. Mein Co-Autor Lucas sagt immer Marke können nicht erfunden, sondern müsse gefunden werden. Er setzt bei Marken- und Unternehmensentwicklungs-Prozess darauf, möglichst viele zu hören. Wenn man das weiterdenkt, geht es nicht nur ums Zuhören, sondern vielleicht auch ums Vermitteln und Moderieren, oder?
Auf jeden Fall! Das journalistische Zuhören bedeutet, dass wir Anliegen und Sichtweisen aufnehmen – und dann auch strukturieren und auswerten. Das Ergebnis muss aber nicht immer eine Publikation sein. Es kann das Vermitteln eines Gesprächs sein, das Aufstellen eines Workshops, die Organisation einer Veranstaltung.
Auf der Website des Instituts für angewandtes Zuhören, das du gegründet hast, steht: „Begegnung und Austausch werden wichtiger. Das Zuhören und seine persönlichkeitsstärkende und gemeinschaftsfördernde Wirkung rücken ins Zentrum.“ Ich finde das ein sehr gutes Schlusswort. Dennoch die Frage: was wünschst du dir abschliessend fürs Zuhören?
Zwei Dinge: Dass wir uns immer wieder bewusst machen, wie zentral Zuhören für gute Kommunikation ist. Und dass wir verstehen, wie wichtig Zuhören ist, wenn wir eine Gesellschaft zusammenhalten wollen.
Weitere Projekte von Peter: Mit der Journalistin Lena Jakat hört er seit seit Oktober 2024 im Eichenau Podcast zu. Seit 2019 führt er bereits für meisterstunde.de befragt er Menschen nach ihren Lebenslehren, die in einem Fachgebiet zu den Erfahrensten zählen. Gerald von Foris setzt sie ins Bild. Mit der Art Directorin Joanna Mühlbauer gründete er den Malus Verlag, in dem sie fünf Jahre lang Das Buch als Magazin herausgaben.
Mehr zum Thema im Blog: der republica-Talk „Mehr Aufmerksamkeit für Aufmerksamkeit“ und das Minifesto „Wesentlich weniger“