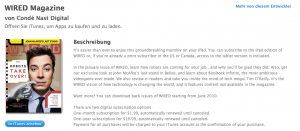Ich hatte es vergessen. Ich benutze das iPad nicht so begeistert und vor allem nicht so häufig, dass mir aufgefallen wäre, dass ich vor etwa einem Jahr zwar ein Wired-Abo (US-Ausgabe) abgeschlossen, aber nie eine Ausgabe gelesen hatte. Heute wurde ich daran erinnerte: eine automatische Mail informierte mich über eine Erhöhung des Abo-Preises. „Falls Sie Ihr Abo zu diesem höheren Preis nicht verlängern möchten,“ steht in der Mail, „können Sie die automatische Verlängerung deaktivieren.“ Die Mail kommt nicht von Wired. Sie wurde nicht vom Chefredakteur verfasst und auch nicht vom Vertriebsleiter bei Conde Nast. Sie kommt von einem iTunes-Automaten.
Nicht nur weil es beim Abo-Preis um einen vergleichbaren Betrag geht, musste ich an Andrew Sullivan denken als ich die Mail las. Andrew Sullivan erlangte zu Beginn des Jahres auch bei digital eher uninteressierten Menschen eine gewisse Aufmerksamkeit, weil er sich mit einem ziemlich Knall als Journalist von der früher notwendigen Medienmarke löste. „Daily Dish“ heisst die Marke, die Sullivan (mit seinem Team) selbst erschaffen hat. „Daily Dish“ wird ab Februar auf eigenen Beinen stehen – dank seiner Leser.
Der Kontrast zwischen Wired-Abo und Andrew Sullivan ist vielleicht nur ein zeitlicher Zufall. Ich lese ihn aber als Beispiel für den Wandel, den wir dieser Tage erleben. Es ist ein Wandel in der Art, wie für Journalismus (auch) bezahlt wird. Wir erleben eine sich gründende Bezahlkultur, die einerseits beweist, dass die Rede von der Kostenloskultur nicht konstruktiv ist und andererseits den Gedanken nahelegt: Inhalte werden im digitalen Raum (auch) anders gekauft als im analogen.
Andere haben das schon früher und besser aufgeschrieben, deshalb erlaube ich mir, die vier wichtigsten Schlussfolgerungen aus dem Beispiel Daily Dish zu ziehen und dabei eine These fortzuführen, die ich vor ziemlich genau einem Jahr (vermutlich als ich das Wired-Abo abschloss) am Beispiel von Wikipedia aufgestellt habe: Es wird im Netz sehr wohl bezahlt, aber in einem anderen Kontext.
Den Beweis dafür liefert übrigens keineswegs nur Andrew Sullivan. Die Crowdfunding-Beispiele dieser Tage (ja, vielleicht auch ein wenig mein eigenes) sowie Ansätze wie Marco Arments The Magazine oder John Grubers Mitglieds-Modell bei daringfireball stehen für den beschriebenen Wandel, den man ganz aktuell auch in Deutschland verfolgen kann: in den Einträgen (und vor allem in den Kommentaren) von Markus Beckedahl auf netzpolitik.org aber z.B. auch in der Geschichte des Motorbloggers Hahne.
Das Verhältnis zwischen Bühne und Publikum wird aktuell neu verhandelt. Vielleicht erstmal nur in Nischen und bei Spezial-Themen, die auslösende Veränderung gilt aber auch für den Massenmarkt. Es kann also nicht schaden, dieser Veränderung Beachtung zu schenken: Der Rezipient wird aktiv, Publikation wird zu Kommunikation und Kreativität (als schönerer Oberbegriff für den von Kreativen produzierten Content) wird auch direkt bei Kreativen gekauft – mit Folgen für Kommunikation, Vertrieb und womöglich auch Produktion von Inhalten; auch in Massenmedien.
Vier Beobachtungen:
1. Andrew Sullivan ist mit Daily Dish zu einer eigenen Marke geworden. Klingt alt, muss aber offenbar immer wieder neu verstanden werden. Es sind nicht mehr einzig Medienmarken, die Orientierung im unübersichtlichen Raum liefern. Es sind vor allem Menschen. Menschen, die greifbar sind und die darstellen, was sie tun. Zu häufig noch wird dieser Prozess mit selbstdarstellerischer Eitelkeit beschrieben, zu selten wird das digitale Auftreten wie das in der Kohlenstoffwelt verstanden: Wer sich frisiert und ordentlich anzieht, ist kein Selbstdarsteller. Wer ein paar Grundregeln im Auftreten beachtet, ist nicht eitel. Das gilt für das persönliche Gespräch genauso wie für die digitale Existenz. Anders ausgedrückt: Nur wer für etwas steht, kann seinen Lesern erklären, warum sie ausgerechnet ihm oder ihr Aufmerksamkeit schenken sollen. Und das ist Voraussetzung um überhaupt über Bezahlen im Netz nachdenken zu können.
2. Verkaufen gehört offenbar zum Handwerk: Wer Sullivan oder dem Prinzip Crowdfunding böse will (Lektüre-Empfehlung: dieser Beitrag aus der FAZ), beschreibt es abfällig und womöglich sogar als Betteln. Und es stimmt ja auch: Im direkten Kontakt zum Leser Inhalte anzubieten, heißt auch, sie zu verkaufen. Dafür muss man für etwas stehen und das auch vertreten. Und dafür muss man womöglich auch: Klinken putzen, den Kontakt zu Redaktionen (die womöglich der profesionellen Pressearbeit müde geworden sind und sich genau danach sehnen) suchen und auch zu den Menschen, die am Ende bezahlen sollen. Man muss sich die Mühe machen, ihnen einen Grund zu liefern. Denn das ist ja das Besondere an der aktuellen Situation:
3. Es gibt Menschen, die offenbar bereit sind, auf diese Art für Journalismus zu zahlen. Jahrelang gefiel sich die Branche ein bisschen zu sehr im selbstmitleidigen Wehklagen über die Digitalisierung. Spätestens die Entwicklung der vergangenen Wochen beweist, was man schon vorher gewusst hat: Das hilft nicht. Die kleinen Erfolge zeigen vielmehr, dass Neues möglich ist. Vielleicht in kleinerem Rahmen als gewünscht, vielleicht in Nischen und vielleicht noch nicht nachhaltig. Aber es funktioniert. Und daraus lassen sich Schlüsse ziehen. Der wichtigste ist dieser hier:
4. Industrielle Kreativität wird von individueller Kreativität ergänzt. Womit wir wieder bei dem zu Beginn beschriebenen Wired-Kontrast sind. Die automatisierte Mail vom iTunes-System und der direkte Austausch mit einer greifbaren Person wie Andrew Sullivan – hier zeigen sich zwei sehr unterschiedliche Ansätze im Leserdialog und in der Bezahlbegründung. Diese sind nicht neu. Neu scheint für viele: Die direkte Wertschätzung kann Wert generieren. Wo Menschen ernst genommen werden, wo echter Dialog entsteht, liegt womöglich auch eine Bezahlbereitschaft.
Diesen Dialog muss man lernen. Er war nicht nötig und ja tatsächlich auch nicht möglich zu Zeiten der Publikationsmonopole. Heute gehört er zum journalistischen Handwerk. Er ist Vorraussetzung um Relevanz zu erzeugen, um Begründungen für Wertschätzung zu liefern und er ist vielleicht auch ein Schlüssel für Geschäftsmodelle im digitalen Raum. Vielleicht auch nicht. Man wird es aber nur rausfinden, wenn man sich drauf einlässt.
P.S.: Das zum Einstieg erwähnte Wired-Abo lasse ich übrigens weiterlaufen. Ich mag das Magazin, mir gefallen die Inhalte und die Automaten-Mail war eine gute Erinnerung. Ich schreibe dies, weil der Wert spannender Inhalte natürlich der zentrale Hebel auch für das Verkaufen im Netz bleibt. Wir sollten uns davon jedoch nicht blenden lassen: Es geht auch darum, diesen Wert entstehen zu lassen. Es geht auch darum, diesen Wert zu benennen. Dabei gerät gerade etwas in Bewegung. Das wird eine gute Bewegung sein, wenn es uns gelingt, ihren Rhythmus und ihr Prinzip zu verstehen und aufzunehmen.